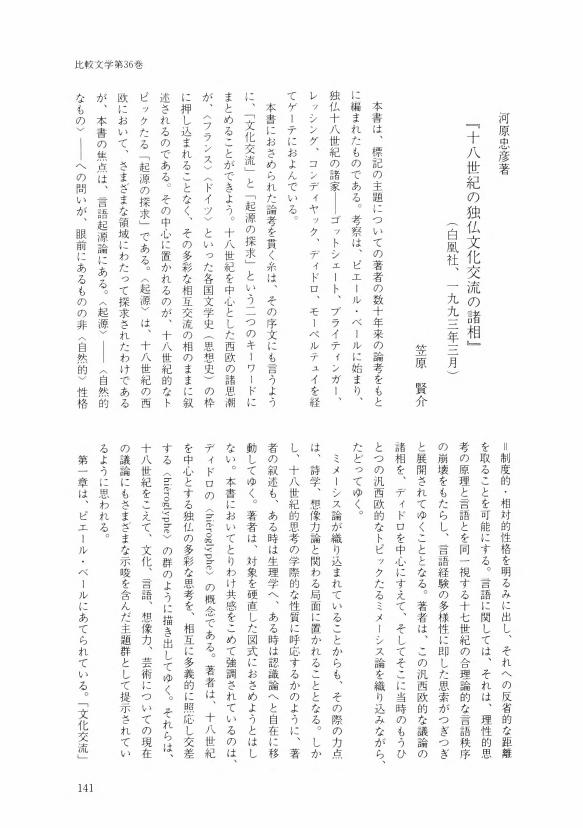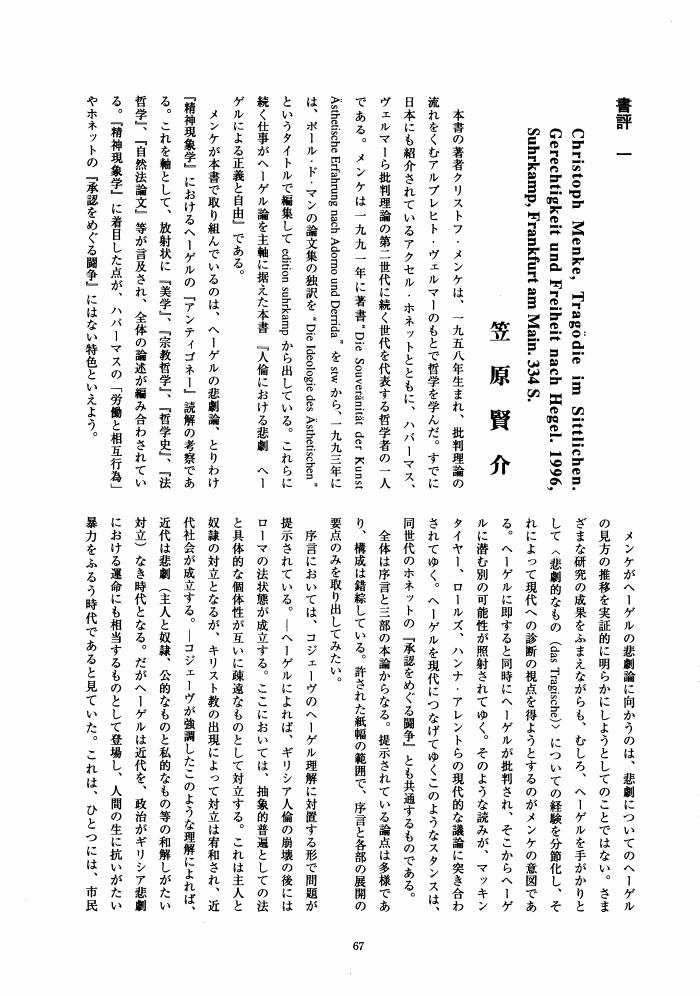3 0 0 0 OA 河原忠彦著 『十八世紀の独仏文化交流の諸相』
- 著者
- 笠原 賢介
- 出版者
- 日本比較文学会
- 雑誌
- 比較文学 (ISSN:04408039)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.141-144, 1994-03-31 (Released:2017-07-31)
1 0 0 0 OA 初期レッシングのスピノザ理解
- 著者
- 笠原 賢介
- 出版者
- 法政大学教養部
- 雑誌
- 法政大学教養部紀要. 人文科学編 (ISSN:02882388)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.51-76, 1985-01
1 0 0 0 OA レッシングとフリードリヒ・シュレーゲル オリエント観をめぐって
- 著者
- 笠原 賢介
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.38-49, 2017 (Released:2019-08-06)
Friedrich Schlegel hat zwischen 1797 und 1804 einige Lessing-Aufsätze geschrieben. Dort hat er den „geselligen“ Stil Lessings, der das „Selbstdenken“ des Lesers erregt, hochgeschätzt. In diesem Zusammenhang hat Schlegel Nathan den Weisen als „Krone“ der Lessingschen Werke bezeichnet. „Selbstdenken“ ist das Schlagwort der Aufklärung. Hier besteht eine Kontinuität zwischen Lessing und Schlegel. In Über die Sprache und Weisheit der Indier (1808) zieht er nun eine Scheidelinie zwischen den flektierbaren indoeuropäischen Sprachen und den anderen Sprachen, wie z. B. Chinesisch, Hebräisch und Arabisch. In Über Lessing (1797) schreibt er: „der durchgängig zynisierende Ausdruck [von Nathan dem Weisen] hat sehr wenig vom orientalischen Ton“. Für Lessing handelt es sich jedoch nicht um den Ton der Sprache, sondern um den Hinweis auf den schmalen Weg zum friedlichen Zusammenleben von Orient und Okzident. Trotz der Wertschätzung von Nathan dem Weisen ist bei Schlegel eine Veränderung des Orient-Bildes festzustellen.
- 著者
- 笠原 賢介
- 出版者
- Japanische Hegel-Gesellschaft
- 雑誌
- ヘーゲル哲学研究 (ISSN:13423703)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.4, pp.67-69, 1998-06-11 (Released:2010-07-27)
- 被引用文献数
- 1 2
1 0 0 0 IR ニーチェとプラトン
- 著者
- 笠原 賢介
- 出版者
- 法政大学文学部
- 雑誌
- 法政大学文学部紀要 = Bulletin of Faculty of Letters, Hosei University (ISSN:04412486)
- 巻号頁・発行日
- no.79, pp.15-29, 2019
Der Aufsatz basiert auf dem Vortrag, der am 23. Juni 2018 anlässlich des vom Philosophischen Seminar der Hosei Universität Tokyo veranstalteten öffentlichen Symposiums „Platon und Gegenwart" gehalten wurde. Zuerst wird der Gegensatz zwischen Nietzsche und Platon bezüglich der Kunst anhand der Geburt der Tragödie und des 10. Buchs vom Staat herausgestellt. Dabei handelt es sich um das Verständnis für den Begriff „mimêsis". Die Platon-Kritik Nietzsches bedeutet aber nicht, dass er Ästhetizist bzw. Irrationalist sei. In diesem Zusammenhang werden die geläufigen Nietzsche-Bilder seit der vorletzten Jahrhundertwende, wie z. B. „Dichterphilosoph", „Lebensphilosoph" oder „Nietzsche als Machtpolitiker" à la Baeumler, rückblickend rekonstruiert. Wie M. Montinari philologisch und M. Heidegger philosophisch klargemacht haben, haben sie heute keine Gültigkeit mehr. Durch die Herausgabe der Kritischen Gesamtausgabe 1967 sind Nietzsches Texte von dem Schema, das das „Hauptwerk" Der Wille zur Macht verbreitet hatte, befreit worden. Der philosophische Gedankengang Nietzsches muss zwischen den Zeilen seiner Schriften -einschließlich der Nachlässe- herausgelesen werden.G. Picht hat zur Auslegung der Philosophie Nietzsches einen wichtigen Beitrag geleistet. Auch für das Thema „Nietzsche und Platon" ist seine Nietzsche-Interpretation aufschlussreich. In meinem Aufsatz werden zwei Punkte seiner Deutung hervorgehoben: ⑴ Genese, die bei Nietzsche als Polarität von dem „absoluten Flusse" der Zeit und der „imaginären Gegenwelt" des Lebewesens aufgefasst wird. ⑵ Kunst, die gleichbedeutend mit der griechischen „poiêsis" ist. Mit dem Wort Kunst meint Nietzsche nicht nur die Kunst im engeren Sinne, sondern das Hervorbringen überhaupt. Das Hervorgebrachte wird als öffentlicher Spielraum „Geschenk" für die Menschen, das nicht ausgeschöpft werden kann.Nietzsche steht in krassem Gegensatz zu Platon, der sich auf die überzeitliche „idea" richtet. Zwischen den beiden gibt es trotzdem einige Schnittpunkte. In dieser Hinsicht wird abschließend Platons Gastmahl betrachtet. Dabei handelt es sich um das Wort „tokos" in Diotimas Dialog mit Sokrates und das Wort „bakcheia" in der Rede von Alkibiades. A. N. Whitehead hat gesagt: „Die philosophische Tradition Europas besteht aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon." Damit meint er nicht „das systematische Schema des Denkens, das Gelehrte aus seinen Schriften zweifelhaft herausgezogen haben", sondern „den Reichtum der allgemeinen Ideen, die in ihnen zerstreut sind". In diesem Sinne hat auch Nietzsche einige Fußnoten zu Platon hinzugefügt, sich mit ihm auseinandergesetzt und eine neue Denkrichtung eröffnet.