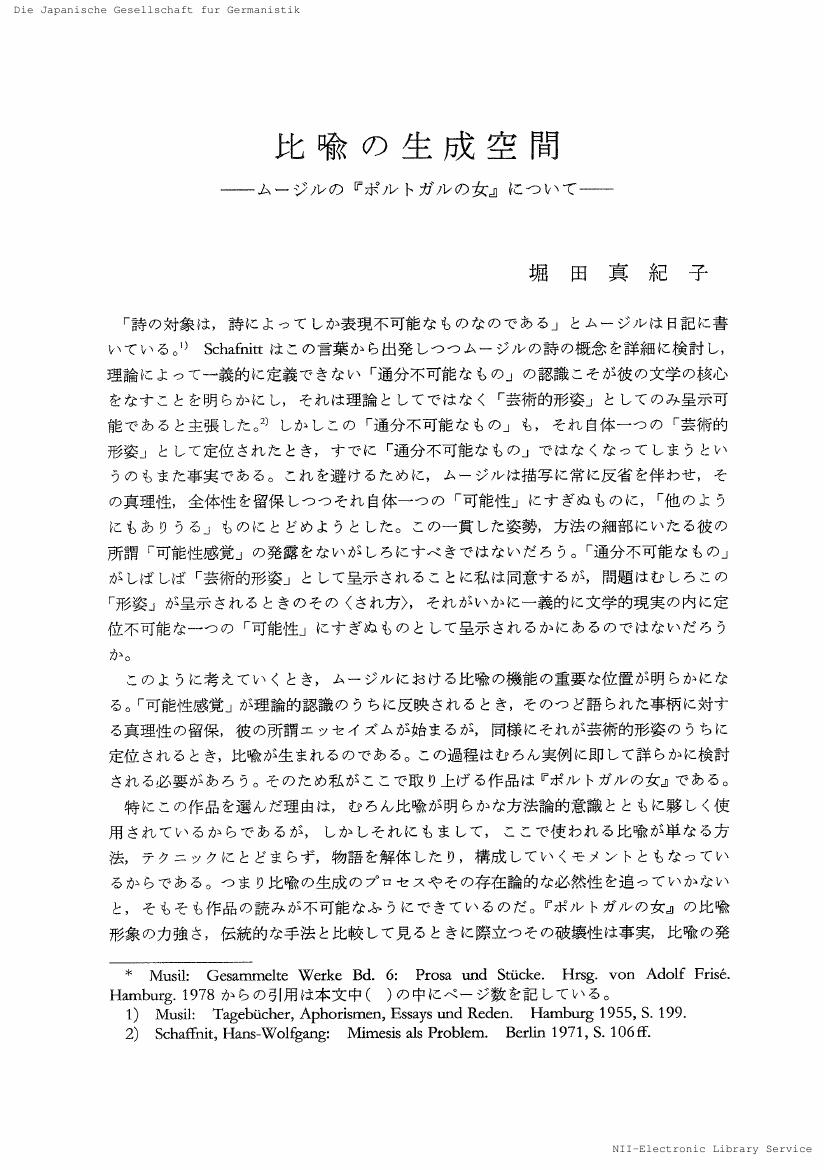1 0 0 0 OA 作者と権威 「再現前的公共圏」の復権とユンガー『鋼鉄の嵐のなかで』
- 著者
- 稲葉 瑛志
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.160, pp.78-92, 2020 (Released:2021-06-04)
In seinem Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) beschrieb Jürgen Habermas die Entfaltung der „repräsentativen Öffentlichkeit“, die an Status und Attribute der autoritären Person geknüpft ist. Er äußerte die Ansicht, dass im 20. Jahrhundert die Öffentlichkeit angesichts der Auflösung kritischer Publizität in manipulative Werbung verwandelt wurde. In anderer Hinsicht wies Peter Trawny in Die Autorität des Zeugen (2009) darauf hin, dass in den 20er Jahren die Entziehung der Souveränität wegen des Versailler Vertrags und die Schwächung der Demokratie für Unruhe im Deutschland sorgten und dass daher das Verlangen nach politischer Autorität im rechten Diskurs stieg. Besonders in revolutionären und nationalistischen Gruppen von Männern, deren Ziel der Untergang der Republik war, wurde der Dichter zur sakralen Figur des Propheten hochstilisiert. Es wurde also im 20. Jahrhundert die Frage nach der Autorität in der Öffentlichkeit wieder gestellt. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel der vorliegenden Arbeit zu untersuchen, wie Ernst Jünger, ein zunächst unbekannter Schriftsteller, durch seinen Kriegsroman In Stahlgewittern (erste bis dritte Fassung: 1920-24) die Autorität des Autors erlangt. Dabei wurde seine Strategie der Erlangung von Autorität in Hinsicht auf „Selbst-Heroisierung“ im Text und Anerkennung durch die Lesern analysiert. Nach dem Ersten Weltkrieg stellten sich einerseits den Historikern, die die Front nicht miterlebt hatten, die schwierige Frage, wie sie die Ungeheuerlichkeiten des Weltkriegs erzählen konnten, da dieser in der Wahrnehmung des Erlebenden eine Katastrophe alles Bisherige übersteigenden Ausmaßes war. Andererseits verbreitete sich der Diskurs, dass nur die zurückgekehrten Kriegsteilnehmer das „Geheimnis der Front“ kennen konnten. Den von Kriegsheimkehrern geschriebenen Werken wurde auf diese Weise in der Nachkriegsgesellschaft Beglaubigung verliehen. In diesem politisch-sozialen Kontext entstand In Stahlgewittern als die retrospektive Bearbeitung der vierzehn vom Autor im Feld geschriebenen Tagebücher. Der Text ist zwar ein von Jünger literarisiertes Werk, aber die Ereignisse werden im Text mit verschiedenen rhetorischen Mitteln als „Wahrheiten“ erzählt und der Autor wird als anerkennenswerter Held stilisiert. Im betreffenden Diskurs der Nachkriegsgesellschaft versuchte Jünger durch den im sachlichen Telegrammstil verfassten Ordensbericht, bezeugte Aussagen seines Bruders und mit der eigenen Unterschrift versehene Fotos das Geschehen an der Front als Heldisches zu inszenieren. Dadurch glaubt ein naiver Leser eine Einheit von Text und Leben zu erkennen. Das heißt also, dass sich Jüngers Text als Versuch sehen lässt, sowohl Fiktion als auch historische Quelle zu sein. Dazu beansprucht der Autor im Text die Autorität eines herausragenden, heldischen Offiziers an der Front. Er inszeniert den Ich-Erzähler als ehrenvolle Person, indem er ihn mit den für nationalistische Leser weit verbreiteten Topoi der politischen Kultur Deutschlands umgibt (z. B. „Landsknechtsboom“ oder „Duellkultur“). (View PDF for the rest of the abstract.)
1 0 0 0 OA 文献学と歴史 グリムからベンヤミンへ
- 著者
- 宇和川 雄
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.146, pp.119-132, 2013-03-25 (Released:2018-03-31)
1 0 0 0 OA 『屋根裏の散歩者』から『猫町』へ 『群衆と観相学 / 群衆の観相学』の序にかえて
- 著者
- 平野 嘉彦
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, pp.1-14, 2006-10-30 (Released:2018-03-31)
1 0 0 0 内面世界に映る歴史:『タウリスのイフィゲーニエ』試論
- 著者
- 柴田 翔
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.86-94, 1968
1. Analyse des Werkes<br>In der Welt der <sub>"</sub>Iphigenie“ herrschen die Ahnung von der wesentlichen Tragik des menschlichen Daseins und die stille, klare Fülle des Lebens, die gerade in dieser Ahnung sichtbar wird.<br>Das Tantalus-Geschlecht ist von den Göttern verflucht. Seine Mitglieder werden von einer ungeheueren Wut getrieben, eine Tat ruft die Rache des anderen nach sich, und ihr Leben ist eine endlose Kette aus Vergeltung und Wiedervergeltung. Jede Tat, die sie aus eigenem Willen tun und für gerecht halten, wird gerade zur Verwirklichung des Götterfluchs.<br>(Orest und die Sehnsucht nach dem Tode) Orest kann dieses verfluchte Dasein nicht mehr ertragen. Obwohl er aus Tantalus' Geschlecht ist und die alte Wut als Familienblut in sich hat, paßt seine menschliche Seele zu dem übermenschlichen Maß der alten Wut nicht mehr. Er sehnt sich nach der Totenwelt, wo alles verziehen und versöhnt wird.<br>(Pylades und das Prinzip der Zweckmäßigkeit) Pylades, der nicht zu Tantalus' Geschlecht gehört und damit außerhalb des verfluchten Kreises steht, glaubt fest an die Fähigkeit im Menschen und will Orest mit Hilfe eines durchdachten Planes retten.<br>(Iphigenie und das Vorrecht des Gefühls) Iphigenie dagegen kann nur dem eigenen Gefühl folgen und den von Pylades gefaßten Plan nicht ausführen, weil ihr Gefühl es nicht zuläßt, den König Toas zu betrügen. Damit wagt sie es, das Leben Orests, das des Pylades und ihr eigenes zu gefährden. Doch ist es für Iphigenie keine Lösung, Orest mit Hilfe von Pylades' Plan aus Tauris nach Mykene zu bringen. Die verfluchte Rachekette will sie nun endgültig durchschneiden. Wenn sie aber jetzt Toas nach dem Plan des Pylades betröge, würde sie damit das erste Glied einer neuen Kette schmieden. Sie glaubt, daß ihr Gefühl sie zum Rechten führen wird. Mit dem Wort des Toas <sub>"</sub>Lebt wohl!“, das am Ende des Stückes steht, breitet sich vor uns eine Welt aus, in der alles versöhnt und verziehen ist und doch-anders als bei Orest-die stille Fülle des Lebens herrscht.<br>2. Seine Lage<br>In der <sub>"</sub>Iphigenie“, die im Jahre 1787 ihre endgültige Fassung erhielt, sieht der Dichter das Wesen des menschlichen Daseins eben in dem Verflucht-Sein des Tantalus-Geschlechts. In ihm war die Ahnung, daß in Europa eine Geschichtsperiode ruheloser Bewegungen und Umstürze des ganzen sozialen und politischen Gefüges heraufzieht. Er fühlte diegleiche Wut wie die des Tantalus-Geschlechts im eigenen Innern und damit die Wut derjenigen, die dazu bestimmt waren, sich an den Geschehnissen dieser Revolutionsperiode zu beteiligen.<br>Aber Goethe selber wollte sich dabei nicht engagieren. In Pylades sah er das Bemühen und Schicksal der aufklärerischen Revolutionäre, die die Geschichte nach dem Prinzip der Gerechtigkeit und aus eignem Willen Ienken wollten und doch in Wirklichkeit gerade umgekehrterweise von der Gewalt der unübersehbaren Geschichte geleitet wurden. In Orest sah er schon die Gestalt der kommenden Romantiker voraus, die, durch die ungeheuere Wendung der Geschichte ermattet, in der Totenwelt der Nacht und des Katholizismus Zuflucht suchten. Er selber wollte aber weder den Weg des Pylades noch den des Orest gehen. In der Gestalt der Iphigenie suchte er die Möglichkeit, an das menschliche Gefühl als das letzte Kriterium zu glauben in der Hoffnung, dadurch die Unruhe der Zeit überwinden zu können. Denn für ihn war die Fülle des Lebens wichtiger als die Gerechtigkeit, und ihm schien, daß diese Fülle nicht im Kampf ums Recht, sondern im stillen Genießen des friedlichen Alltags zu finden sei.<br>3. Aussicht<br>Die Geschichte aber schreitet über Wunsch und Versuch Goethes weiter fort.
1 0 0 0 数学史の中に置いたムージル『寄宿生テルレスの混乱』
- 著者
- 高次 裕
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.148, pp.209-223, 2014
- 著者
- 稲葉 瑛志
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.78-92, 2019
1 0 0 0 OA 肉体液状化の恐怖 68年世代とナチスを結ぶファシズム身体論
- 著者
- 越智 和弘
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.144, pp.114-131, 2012-03-25 (Released:2018-03-31)
- 著者
- 風岡 祐貴
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.146, pp.133-149, 2013
1 0 0 0 OA 比喩の生成空間 ムージルの『ポルトガルの女』について
- 著者
- 堀田 真紀子
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文學 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, pp.100-111, 1997-10-15 (Released:2018-03-31)
1 0 0 0 OA わがゲーテ史
- 著者
- 向坂 逸郎
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文學 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.179-183, 1949-10-20 (Released:2008-03-28)
1 0 0 0 ツェラーン
- 著者
- 相原 勝
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.133, pp.219-232, 2007
1 0 0 0 OA シラーの方法
- 著者
- 木本 欽吾
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文學 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.7-11, 1953-11-20 (Released:2009-01-29)
1 0 0 0 OA 有限性と無限性との間の浮遊
- 著者
- 大田 浩司
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.146, pp.24-39, 2013-03-25 (Released:2018-03-31)
1 0 0 0 OA 関口存男著「冠詞」第1巻を読んで
- 著者
- 橋本 文夫
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文學 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.117-120, 1960-11-05 (Released:2008-03-28)
1 0 0 0 OA 「はじめて書きつけた慣れない手つきの文字」に出会うための散歩
- 著者
- 新本 史斉
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, pp.24-35, 2004-10-05 (Released:2018-03-31)
1 0 0 0 OA 魂から身体への反転
- 著者
- 田邊 玲子
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.144, pp.1-18, 2012-03-25 (Released:2018-03-31)
1 0 0 0 OA 中井千之著『予感と憧憬の文学論』
- 著者
- 小林 信行
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文學 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, pp.145-147, 1996-03-01 (Released:2008-03-28)
- 著者
- 小黒 康正
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.154, pp.103-121, 2017-03-25 (Released:2018-03-31)
„Auch bei uns wird der Aufruf zum dritten Reich laut.“ So schrieb Minoru Nishio (1889–1979) in der japanischen Zeitschrift Erziehung in Shinano im März 1914. Es ist allgemein bekannt, dass der in München entwickelte Nationalsozialismus die Idee des dritten Reiches als Propaganda für seine „Neue Ordnung“ übernahm. Aber schon vorher spielte diese Idee auch in der während der Weimarer Republik sich mehr und mehr artikulierenden konservativen Revolution eine große Rolle. Ihr Haupttheoretiker Moeller van den Bruck hat 1923 sein letztes Werk veröffentlicht, dessen Titel Das dritte Reich dem Nationalsozialismus als propagandistisches Schlagwort diente. Erst danach ist der heikle Kampfbegriff in Deutschland populär geworden, obwohl Dietrich Eckart (1868–1923) ihn schon 1919 als Mitbegründer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei prägte. (View PDF for the rest of the abstract.)
1 0 0 0 OA 坂内正著「カフカの『審判』」,「カフカの『城』」,「カフカの『アメリカ』(失踪者)」
- 著者
- 有村 隆広
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文學 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, pp.180-183, 1990-10-01 (Released:2008-03-28)