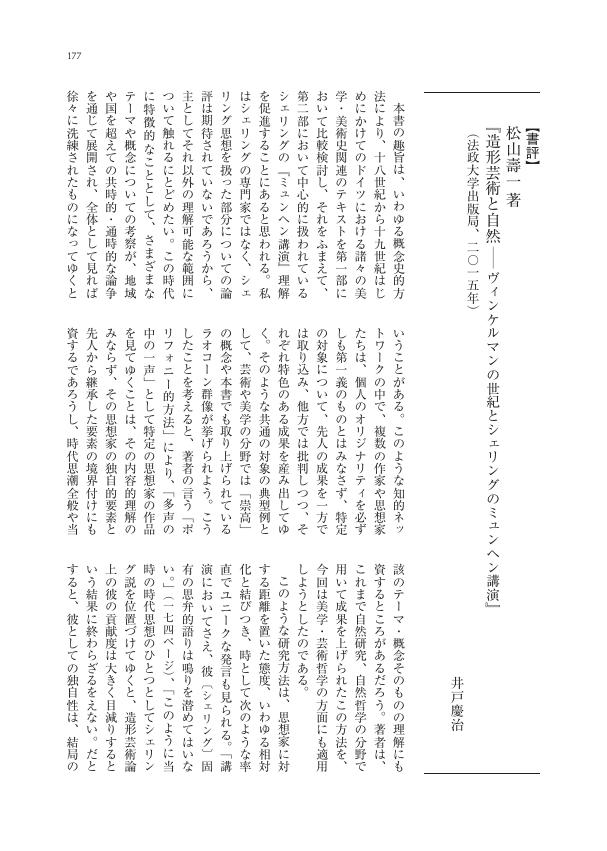1 0 0 0 OA 編集後記
- 著者
- 田中 均
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.197, 2016 (Released:2020-03-26)
1 0 0 0 OA 自覚・意志・直観 自由をめぐるシェリングと西田の一断面
- 著者
- 秋富 克哉
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.4-14, 2017 (Released:2019-08-06)
Der vorliegende Aufsatz setzt sich mit dem Denken Nishidas in seiner früheren Periode, konkret gesagt den Prozess der Entwicklung von „der reinen Erfahrung“ zum „Selbstgewahren“, weiter zum „Willen der absoluten Freiheit“ als dem Hintergrund des Selbstgewahrens und schließlich von diesem „Willen“ zum „Ort“ auseinander. Das geschieht vor allem unter dem Gesichtspunkt des Zusammen- hangs mit der Freiheitsabhandlung Schellings: Sowie Schelling „Gott, sofern er existiert“ und „den Grund seiner Existenz“ unterscheidet, hält Nishida den Unterschied zwischen „Natura creans et non creata“ und „Natura nec creata nec creans“ bei Scotus Eriugena für wichtig. Nishida bestimmt diesen Unterschied als das Verhältnis zwischen „Wille“ und „Anschauung“ und entwickelt den Standpunkt der Anschauung in Gestalt des „Ortes“ weiter. Die Positionen der beiden Philosophen zur Freiheit des Willens, so zeichnet sich ab, weisen deutliche Parallele auf.
1 0 0 0 OA ヒメラのペトロンと「母たち」 世界の複数性の時代におけるゲーテのオリエント観
- 著者
- 坂本 貴志
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.50-59, 2017 (Released:2019-08-06)
Agostino Steuco zufolge geht es in seinem Traktat ‚philosophia perrenis‘ um die Einsicht in die Weisheit, die am Anfang Adam zugeteilt wurde, und die aber nach der Erbsünde, zwar in einer Art der Verartungen, dennoch in den Erinnerungen an den Ursprung, den Nachkommen verkündet wurde. Zu dieser uralten traditionellen Denkweise der ‚philosophia perrenis‘, die auf den gesamten Wiederaufbau dieser Weisheit zielt, zählen neben den (Neu)Platonikern und den Philosophen der Renaissance vor allem Kircher, Leibnitz, Gottsched und Herder, indem alle nach dem einzigen Ursprung der Offenbarung auf der Erde im Hinblick auf die anderen Religionen sowie auf die möglichen Wesen der Bewohner auf den anderen Planeten suchten. Goethe hält von dieser zu monogen tendierten Denkweise Distanz, indem er eine Offenbarungsreligion als ein symbolisches Medium auffasst, durch das die Menschen wie bei der Natürlichen Religion zu einem über alle Erdkörper erhabenen Gott geführt werden. Goethes West-Östlicher Divan sowie seine poetische Figur ‚Mütter‘ in Faust bieten für diese These reichliche Beweisgründe dar.
1 0 0 0 OA 「生」の諸相とその展開 ヘーゲルにおける生の交流とその気脈
- 著者
- 栗原 隆
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.126, 2016 (Released:2020-03-26)
Franz Joseph Schelver (1788-1832) war ein Forscher der Botanik, dem Goethe in seiner Zeit an der Jenaer Universität tief vertraut hat. Er war auch ein gemeinsamer Freund von Schelling und Hegel. Hegel rezepierte den Gedanken der Metamorphose von Goethe durch Schelver an. Obwohl Schelling die Metamorphosen-Lehre früher als Hegel annahm, zeigte er dennoch nicht sehr viel Verständnis für die wahre Absicht, welche Goethe in seiner Schrift „Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären“ (1790) ausführlich dargestellt hat. Hegel dagegen begriff diese „geistige Leiter“ in der Metamorphosen-Lehre von Goethe richtig. In meinem Aufsatz versuche ich klar zu machen, daß Hegel mit Hilfe der Idee der „geistigen Leiter“ die Schellingsche Identitätsphilosophie übertreffen wollte.
1 0 0 0 OA キメラの棲まう迷宮 E・T・A・ホフマン『事柄の関係性』の文体
- 著者
- 清水 恒志
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.142, 2016 (Released:2020-03-26)
E. T. A. Hoffmanns „Zusammenhang der Dinge“ in „der Serapions-brüder“ verwirrt die Leser. Die Novelle besteht aus vielseitigen literarischen Elemente. Das Hauptzitat ist Goethes Romanen d. h. „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ und „Wahlverwandtschaften“. Aber zugleich wird der „rote Faden“ als Parodie „entstellt“. Dazu formiert eine Binnenerzählung eine dreifache Fiktion in der Fiktion. Aufgrund von der Kombination der vielen Stoffe und der gründliche Fantasie könnte man die Novel- le „chimärisch“ bezeichnen. Dieses Werk scheint ein trivialer Abenteuerroman zu sein. Aber der Pro- tagonist verweigert, es als Roman und Abenteuer zu bezeichnen. Das ist eine Negation des bisherigen eindeutigen Romanstiles, der unter „Abenteuer“ ein Liebesvorgang oder eine ritterhaften Wanderung versteht. Das ist eine Deklaration, dass diese Erzählung ein literarisches Abenteuer ist, neuen Stil her- zustellen. -Roter Faden, Ungeheuer, Abenteuer- Damit soll man den griechischen Labyrinthsmythos assoziieren. Dieser Aufsatz ist ein Versuch, dass nach F. Schlegels Wort diesen die Leser verwirrende Stil als „Labyrinth“ zu bezeichnen.
- 著者
- 松岡 健一郎
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.167, 2016 (Released:2020-03-26)
Friedrich Schlegel gives several philosophical lectures in Cologne on the assumption that the infi- nite has two conceptual figures, “infinite unity” and “infinite fullness”. In his lectures, there are two different contexts about these concepts and therefore two different entities referred by them. On the first context “infinite unity” and “infinite fullness” are referred to an original and primordial whole- ness of nature and its outside manifold. On the second context “infinite unity” and “infinite fullness” are referred to freedom of the Creator’s “overflowing love” and human’s prospective reflection of it. We can remark that these two concepts of the latter context contain Schlegel’s ethical and theological problematics and they suggest implicitly his own religious turn.
1 0 0 0 OA フィチーノとシェリング
- 著者
- 加藤 尚武
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.114, 2016 (Released:2020-03-26)
The inventions of the telescope and the microscope have forged two divergent paths of of influ- ence. The telescope demolrished the Aristotelian theory of the Universe, that celestial bodies move eter- nally, but bodies under the Moon moved to finite ends. The microscope , meanwhile, created a new metaphysical scope: Beneath the lifeless visual world there is a vibrant world that cannot seen by the naked eye. In this vibrant world Body and Soul- ,Finite and Infinite- ,Being and Nothingness exist in continuity. The continuity entails the truth that in the most fundamental structure of universe, Body = Soul, Finite = Infinite ,Being = Nothing are valid precepts.
- 著者
- 井戸 慶治
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.177, 2016 (Released:2020-03-26)
- 著者
- 菅原 潤
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.187, 2016 (Released:2020-03-26)
- 著者
- 宮田 眞治
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.182, 2016 (Released:2020-03-26)
1 0 0 0 OA シェリングを読む若きショーペンハウアー
- 著者
- 松山 壽一
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.99, 2016 (Released:2020-03-26)
Der junge Schopenhauer liest die verschiedenen Schriften Schellings und schreibt zahlreiche No- tizen davon auf. Sie sammelt der von A. Hübscher herausgegebene handschriftliche Nachlaß (verk. HN). Die vorliegende Untersuchung versucht, drei Gegenstände um Nähe und Ferne zwischen Schel- ling und Schopenhauer aufzuklären, indem der Entstehungsprozeß der Hauptschrift Schopenhauers aus dem genannten Nachlaß abgelesen wird. a) Die in den Philosophischen Briefen (1795-96: WA (1809), S. 165f.), sowie in der Philosophie und Religion (1804, S. 21) dargelegte „intellectuale Anschauung“ identifiziert Schopenhauer zuerst mit seinem eigenen Begriff des „beßren Bewußtseyns“ (HN II, 326). Dieser Begriff wird aber zuletzt (1814) durch einen neuen Ansatz der „Identität des Subjektes der Erkenntniß mit dem des Wollens“ (HN I, 169) ersetzt, womit der erste Schritt zum Standpunkt seiner Hauptschrift Die Welt als Wille und Vorstellung (1818/ 19) getan wird. b) In der Systematik der Naturphilosophie beider Denker findet sich ziemlich viele Ähnlichkeiten; ihre Ansätze stimmen allein nicht ein: zum einen „die absolute Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns“ (Schelling, Ideen (1797), SW II, 56); zum anderen „Identität des Subjektes der Erkenntniß mit dem des Wollens“ (HN I, 169). Wie gesehen, wird einerseits der Begriff des Geistes in den der Natur erweitert; anderseits der Begriff des Willens. c) Was die Kunstphilosophie betrifft, hatte Schopenhauer von fornherein keine große Interesse an die schellingsche Lehre: er hat Schellings Auffassung von der Kunst im letzten Abschnitt des Trans- zendentalsystems (1800) nie erwähnt und zwar zu derselben in den beiden Texten, Bruno (1802) und Münchener Rede (1807), nur wenig kommentiert. Ein auffälligster Unterschied beider Kunstphilo- sophie lag v. a. in der Stellungnahme der Musik. Während sie von Schelling in die niedrigste Stelle der bildenden Kunst eingeteilt wurde, war die Musik für Schopenhauer als „unmittelbar Abbild des Willens selbst“ „von allen andern Künsten verschieden“ (Hauptschrift (1818/19), S. 377).
1 0 0 0 OA よりよき意識と知的直観をめぐって
- 著者
- 鎌田 康男
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.88, 2016 (Released:2020-03-26)
Zu den Grundbegriffen der Philosophie des jungen Schopenhauer gehört der Originalterminus „das bessere Bewusstsein“. Dessen Bedeutungswandel spiegelt den Entwicklungsgang der Früh- philosophie Schopenhauers wider. Die Einführung des „besseren Bewusstseins“ stand durchaus un- ter dem Einfluss der Schellingschen „intellektualen Anschauung“. Die nächste Verwandlung verrät Schopenhauers Annäherung an Fichtes subjektivistische Position. In der dritten Phase des „besseren Bewusstseins“ schließlich versucht Schopenhauer einen Mittelweg zwischen den beiden zu finden. Sein und Wollen gehen nicht mehr über das empirische Bewusstsein hinaus und sind auch nicht dem Machtspruch der Vernunft unterworfen. Damit wurde aber das ursprüngliche Interesse Scho- penhauers an dem, was über das empirische Bewusstsein hinausgeht, aufgegeben. Er wird nun, sich auf Kant berufend, die Grundkonzeptionen der Welt als Vorstellung und der Verneinung des Willens herausarbeiten.
- 著者
- 小野寺 賢一
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.75, 2016 (Released:2020-03-26)
1 0 0 0 OA シンボルと神話の人間学 E・カッシーラーとH・ブルーメンベルクの交差
- 著者
- 千田 芳樹
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.18, 2016 (Released:2020-03-26)
E. Cassirers Hauptwerk „Philosophie der symbolischen Formen“ behandelt vielfältige Kulturfor- men der Menschheit, d.h. Sprache, Mythos und theoretische Erkenntnis. Für ihn ist der Mythos als eine primitive Kulturgestalt wichtig. Er erklärt die ursprüngliche Symbolfunktion der mythischen Weltanschauung (Ausdrucksfunktion). In seinem späteren Werk „Essay on Man“ definiert er die Menschheit als „animal symbolicum“ und betrachtet den Mythos von einem „anthropologischen“ Gesichtspunkt aus. H. Blumenberg behandelt in „Arbeit am Mythos“ diesen unter dem gleichen Gesichtspunkt. Ihm zufolge wird der Mythos als Überwindung der ursprünglichen Angst vor dem „Absolutismus der Wirklichkeit“ geschaffen, was sich bis in die Gegenwart auswirkt. Dieser Aufsatz erklärt die Ursprünglichkeit des mythischen Symbols anhand eines Vergleichs der beiden Theorien und zeigt die Möglichkeit einer Anthropologie von Symbolen und Mythen auf.
1 0 0 0 OA ド・マンのカント/シラー論における「美的なもの」
- 著者
- 田中 均
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.64, 2016 (Released:2020-03-26)
In his lecture, “Kant and Schiller,” Paul de Man argues that “aesthetic ideology” emerged from Schiller’s misunderstanding of Kant. De Man contrasts the “chiasmus” of nature and reason in Schiller’s theory on the sublime as “ideological idealism” with Kant’s “material vision,” devoid of any teleology. I criticize his argument from two viewpoints. First, we find a negation of teleology also in Schiller’s aesthetics, especially in his theory of the “chaotic sublime” as well as in his description of idleness and indifference in “Juno in Ludovici.” Second, Kant’s analytics of the sublime shares “aesthetic purposiveness” with Schiller. I, therefore, conclude that de Man’s oversimplified distinction between Kant and Schiller contra- dicts his own insight into the ambivalent nature of the “aesthetic.”
1 0 0 0 OA 象徴の哲学 生命の論理としてのカバラー
- 著者
- 永井 晋
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.30, 2016 (Released:2020-03-26)
La philosophie de Schelling, particulièrement dans son œuvre monumentale, les Weltalter, est profondément marquée par la kabbale, surtout celle d’Issac Louria. Or, la kabbale consiste, selon notre hypothèse, dans une logique de la Vie divine; celle-ci, étant mouvement vital perpétuel, prend la forme de symboles tels que les sephirots ou les lettres hébraïques pour se révéler. La pratique de la kabbale consiste alors à déchiffrer, en utilisant des moyens inouïs tel que les guématria, ces symboles pour participer à la Vie divine. Telle serait cette logique de la Vie, que Schelling a essayé d’assimiler pour mener à bien son projet de «philosophie positive».
- 著者
- 宮﨑 裕助
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.52, 2016 (Released:2020-03-26)
Friedrich Schiller is the only person that Paul de Man, a Belgian literary critic and theorist, endo- wed with the privileged status of the bearer of what he called “aesthetic ideology.” According to de Man, this is mainly because of Schiller’s misunderstanding of Kant’s aesthetics. By way of questio- ning and developing Schiller’s reception of Kant in his Aesthetic Education of Man, my studies shed light on de Man’s materialism discovered by his meticulous reading of Kant’s Critique of Judgment against Schiller’s ideology. I then remark on de Man’s task of historical materialism interrupted by his death.
1 0 0 0 OA シンポジウム「神話と象徴」司会報告
- 著者
- 加國 尚志
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.41, 2016 (Released:2020-03-26)
1 0 0 0 OA シンポジウム「神話と象徴」について
- 著者
- 加國 尚志
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.46, 2016 (Released:2020-03-26)
1 0 0 0 OA 『赤の書』公刊によるユング再解釈の動向と美術界での反応
- 著者
- 川田 都樹子
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.5, 2016 (Released:2020-03-26)
The Red Book is a large, illuminated volume that was created by Carl Gustav Jung between 1913 and 1930. While Jung considered it to be his most important work and called it his “confrontation with the unconscious,” it was the most influential unpublished work in the history of psychology. Eventually, a complete facsimile and translation was published in 2009. As a result, the tendency to reinterpret Jung is on the rise in the academic world, especially in relation to Schelling’s unconscious. Many artists and art directors today tend to rush into the expression of the unconscious in the art world.