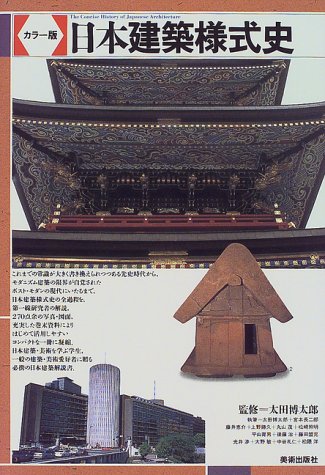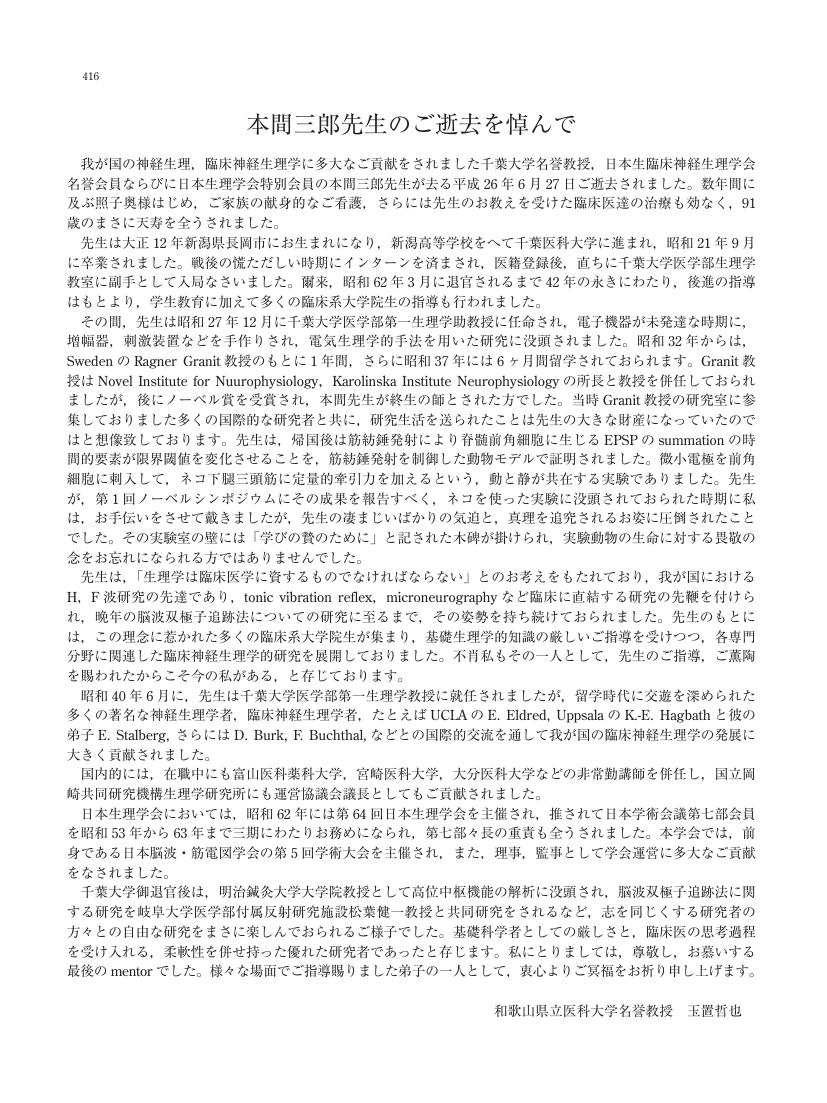2 0 0 0 OA 世界コンピュータ将棋選手権の歴史(5)
- 著者
- 瀧澤 武信
- 雑誌
- ゲームプログラミングワークショップ2019論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, pp.101-108, 2019-11-01
「世界コンピュータ将棋選手権」(第 10 回までは「コンピュータ将棋選手権」)は 1990 年 12 月 2 日に第 1 回(1 日制)が開催され,その後,時期を少しずつ後ろにずらしたため1995年には行われていないが,継続的にほぼ年に 1 回ずつ開催され,2019 年 5 月 3日~5 日(3日制)には第 29回が開催された. 初期のころは上位入賞プログラムも弱いものであったが,2005 年ころから急速に強くなり,今日に至っている.ここでは,第16 回から第 20回までのコンピュータ将棋選手権で活躍したプログラムの実力を検証し,さらに人間プレ ーヤとの対局と今日への繋がりについて考察する.
2 0 0 0 OA なにが行為を行為たらしめるのか シュッツの行為論
- 著者
- 橋爪 大輝
- 出版者
- 日本倫理学会
- 雑誌
- 倫理学年報 (ISSN:24344699)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.159-172, 2022 (Released:2022-07-11)
Alltäglich handeln wir in unserem Leben; das Leben konstituiert sich aus dem Handeln. Was aber ist Handeln? Was unterscheidet das Handeln vom Sich-Verhalten im Allgemeinen und worin liegt das Wesen des Handelns? Diese für die Disziplinen wie Ethik und Sozialwissenschaft grundlegende Frage behandelt der Sozialphilosoph Alfred Schütz in seinem Buch Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Das Ziel der vorliegenden Abhandlung ist herauszuarbeiten, was für ihn das Wesen des Handelns ist und nachzuvollziehen warum es das »Entworfensein der Handlung« ist. Im 1. Abschnitt vergewissern wir uns zuerst, was Schütz unter Sich-Verhalten im Allgemeinen versteht. Für ihn ist das Sich-Verhalten das Erleben mit dem Bewusstsein der Spontaneität, nicht das nur passive Erleben. Wichtig ist weiter der Faktor, der das Handeln vom Sich-Verhalten unterscheidet. Der Schlüssel dafür ist die Schützsche Differenzierung zwischen Handeln und Handlung, weil für Schütz die Essenz des Handelns der Entwurf der Handlung im Voraus ist. Im 2. Abschnitt erörtern wir deshalb diese Differenzierung. Das Handeln im Schützschen Sinne ist der jetzt werdende und entwerdende Ablauf. Die Handlung dagegen ist die bereits abgelaufene, welche man erst in der Reflexion auffassen kann. Sie ist die von den individuellen Elementen mit sinnhafter Artikuliertheit konstituierte und abgeschlossene Einheit. So ist der Entwurf, der für Schütz als konstitutiv für das Handeln gilt, der dieser Einheit, nicht der des Ziels. Im 3. Abschnitt befassen wir uns mit der Struktur dieses Entwurfs in Form einer Untersuchung des paradigmatischen Handelns, des rationalen Handelns. Unsere Schlussfolgerung ist, dass der Entwurf der Handlung einer der Einheit ist, einer aus den individuellen, miteinander verbundenen Bestandteilen(Mitteln) konstituierten Ganzheit. Dies ist laut Schütz das Wesen menschlichen Handelns.
- 著者
- Yusuke Konta Eiichiro Saito Koji Sato Kyohei Furuta Kenichiro Miyauchi Akiko Furukawa Hiroshi Sato Tae Yamamoto
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.21, pp.3239-3243, 2022-11-01 (Released:2022-11-01)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 7
We herein report a case of acute kidney injury (AKI) due to tubulointerstitial nephritis (TIN) after starting empagliflozin in a diabetic patient. The patient developed stage 1 AKI with proteinuria and elevated tubulointerstitial markers. A renal biopsy showed acute TIN with lymphocytic infiltration into the interstitium. The patient's renal function improved after discontinuation of empagliflozin and steroid administration. Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor-induced AKI has been reported, but the underlying mechanism remains unclear, potentially because few patients with SGLT2-inhibitor-induced AKI have undergone a renal biopsy. We report the present case in the hope that it will help clarify the mechanism.
2 0 0 0 OA 機械学習・自然言語処理入門
- 著者
- 髙橋 和子
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.100-115, 2021 (Released:2021-11-26)
2 0 0 0 OA CGによる手話アニメーションの自動生成システム
2 0 0 0 日本建築様式史 : カラー版
2 0 0 0 Argyll Robertson (アーガイルロバートソン)徴候
2 0 0 0 OA 1. 肥満と気管支喘息
- 著者
- 今野 哲
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.7, pp.919-922, 2017 (Released:2017-08-18)
- 参考文献数
- 12
2 0 0 0 OA 黙秘権保障と刑事手続の構造
- 著者
- 石田 倫識
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.244-259, 2014-02-28 (Released:2020-11-05)
2 0 0 0 徳川期大坂城城郭石垣構造の土木史的研究
- 著者
- 天野 光三 西田 一彦 渡辺 武 玉野 富雄 中村 博司
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.660, pp.101-110, 2000
- 被引用文献数
- 1
近世の城郭における石垣構造の技術的頂点に位置するものとして徳川期初期での大坂城石垣がある. 石垣形状での2次元的曲線および3次元的曲面にみられる構造美や構造形式としての力学的合理性からみて, 城郭石垣は世界的に他に例をみない極めて優れたものである. 本研究では, 歴史遺産としての徳川期大坂城城郭石垣をその構造に着目して土木史的研究を行った. まず, 現場調査と文献調査により過去の崩壊事例を明らかにした. 次に, これらの歴史データの分析をもとに抽出した石垣構造形式の力学的合理性に関して, 平面および断面形状に着目した実証的研究を行った. その中で, 石垣構造の安定性評価法として, 石垣構造比および石垣はらみ出し指数といった工学指標について提案した.
- 著者
- WU Jing KUROSAKI Yasunori SEKIYAMA Tsuyoshi Thomas MAKI Takashi
- 出版者
- 公益社団法人 日本気象学会
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023-004, (Released:2022-10-27)
In drylands, the dry vegetation coverage affects dust occurrence by modulating threshold friction velocity (or wind speed) for dust emission. However, there has been little research into quantifying the effect of dry vegetation coverage on dust occurrence. This study investigated spatial and temporal variations of dust occurrence and three definitions of strong wind frequency over the Gobi Desert and surrounding regions in March and April, months when dust occurrence is frequent, during 2001-2021. We evaluated the effects of variations in dry vegetation on dust occurrence by using the threat scores of forecasted dust occurrences for each strong wind definition. Our results indicate that dry vegetation, which was derived from the MODIS Soil Tillage Index, affects dust occurrence more remarkably in April than in March. In March, land surface parameters such as soil freeze-thaw and snow cover, in addition to dry vegetation coverage, should be considered to explain dust variations in that month. However, use of the threshold wind speed estimated from dry vegetation coverage improved the prediction accuracy of dust occurrence in April. Therefore, we propose that the dry vegetation coverage is a key factor controlling dust occurrence variations in April. The findings imply that estimation of dry vegetation coverage should be applied to dust models.
2 0 0 0 OA 新刊吾妻鏡
- 巻号頁・発行日
- vol.巻19-21, 1000
2 0 0 0 OA グローバルアイ〔第61 回〕台湾で働いてはいけない
- 著者
- 福島 宙輝
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.874-876, 2022-11-01 (Released:2022-11-01)
2 0 0 0 OA 植物細胞中の3種類のシュウ酸カルシウム水和物の動態
- 著者
- 石井 裕子
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 日本化学会誌(化学と工業化学) (ISSN:03694577)
- 巻号頁・発行日
- vol.1991, no.1, pp.63-70, 1991-01-10 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 4
シュウ酸カルシウムは水溶液中で一般には一,二,または三水和物の混合物沈殿として生成する。高温では一水祁物のみが生成するが,本研究によれば少量のクエン酸あるいはリンゴ酸ナトリウムの共存の下で二水和物のみが生成し,やや多量のクエン酸またはリンゴ酸ナトリウムの共存の下で三水和物のみが生成した。シュウ酸カルシウムー水和物の溶解度は6×10-5M程度で二水和物および三水和物が一水和物よりやや大きい。一水漁物の溶解度は100℃ではわずかに大きくなった。シュウ酸カルシウムの一,二および三水和物沈殿の形態はそれぞれ長い六角形板状,八面体および平行四辺形板状である。二および三水和物は不安定で水中で約10分煮沸すると一水和物に転移した。シュウ酸カルシウムー水胸物沈殿の結晶核は誘導時間の測定からCa3(C2O4)3n・H2Oと推定できた。シュウ酸カルシウムー水和物および二水和物は植物の葉または茎に見いだされたものと沈殿粒子との形態を比較し,またX線回折によって同定できた。植物中のシュウ酸カルシウム結晶は極めて安定で一水和物に変化するには1時間以上煮沸することが必要であった。
2 0 0 0 OA 心理教育と周囲の支援によって、落ち込みを改善した女子高校生との面接
- 著者
- 宮秋 多香子
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.185-186, 2018-09-30 (Released:2019-04-05)
2 0 0 0 OA 2.服飾材料としての宝石
- 著者
- 辻 禎子 笠井 暢民
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.374-382, 1995-05-25 (Released:2010-09-30)
2 0 0 0 OA 本間三郎先生のご逝去を悼んで
- 著者
- 玉置 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会
- 雑誌
- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.6, pp.416, 2014-12-01 (Released:2016-02-25)
- 著者
- 平舘 ゆう
- 出版者
- 東京藝術大学音楽学部
- 雑誌
- 東京藝術大学音楽学部紀要 = Bulletin, Faculty of Music, Tokyo Geijutsu Daigaku (Tokyo University of the Arts) (ISSN:09148787)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.99-112, 2013
2 0 0 0 OA C線維およびAδ線維を介した咳嗽感受性亢進機序から見た末梢性鎮咳作用機序
- 著者
- 亀井 淳三 林 隼輔 大澤 匡弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.6, pp.429-433, 2008 (Released:2008-06-13)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 3 4
咳は痰を喀出するための反射である.咳のメカニズムは明らかにされていないことが多い.そのためにピンポイントに作用する薬剤がないのが現状である.現在までに明らかにされているメカニズムは複雑である.咳が出る現象について概略を説明すると,気道に炎症があったり,また分泌物が溜まったりすると排出させようとする反射が起きる,それが咳と考えられる.咳反射の中枢への伝達経路はAδという有髄線維によると考えられている.臨床的に鎮咳薬は,咳の末梢あるいは中枢内経路のどの部位を遮断することによって咳を抑制するかが問題となる.例えば,コデインのような中枢作用性の薬剤は咳のメカニズムの中で共通経路を遮断することより効果は大きい.しかし,本来止めてはならない咳も止めてしまう危険性がある.また,中枢抑制の薬剤であるため咳以外の中枢作用,眠気なども低下させる可能性を持つ.これらを考慮すると,中枢性の薬剤で咳を遮断することは好ましくなく,より選択的な手段で鎮咳をもたらすべきである.日本において,鎮咳剤と称されているものは中枢性の鎮咳剤しかない.薬理学的には末梢性鎮咳剤と呼ばれるものがあってしかるべきであるが,実際には認可されていない.その大きな理由としては,咳のメカニズムが明確に示されていなかったことが大きな理由であろう.本稿ではこれらの問題を解決する基礎的知見となるべき咳の咳反射の求心路であるAδ線維の興奮性調節機序,特にC線維を介した咳感受性亢進機序について概説したい.